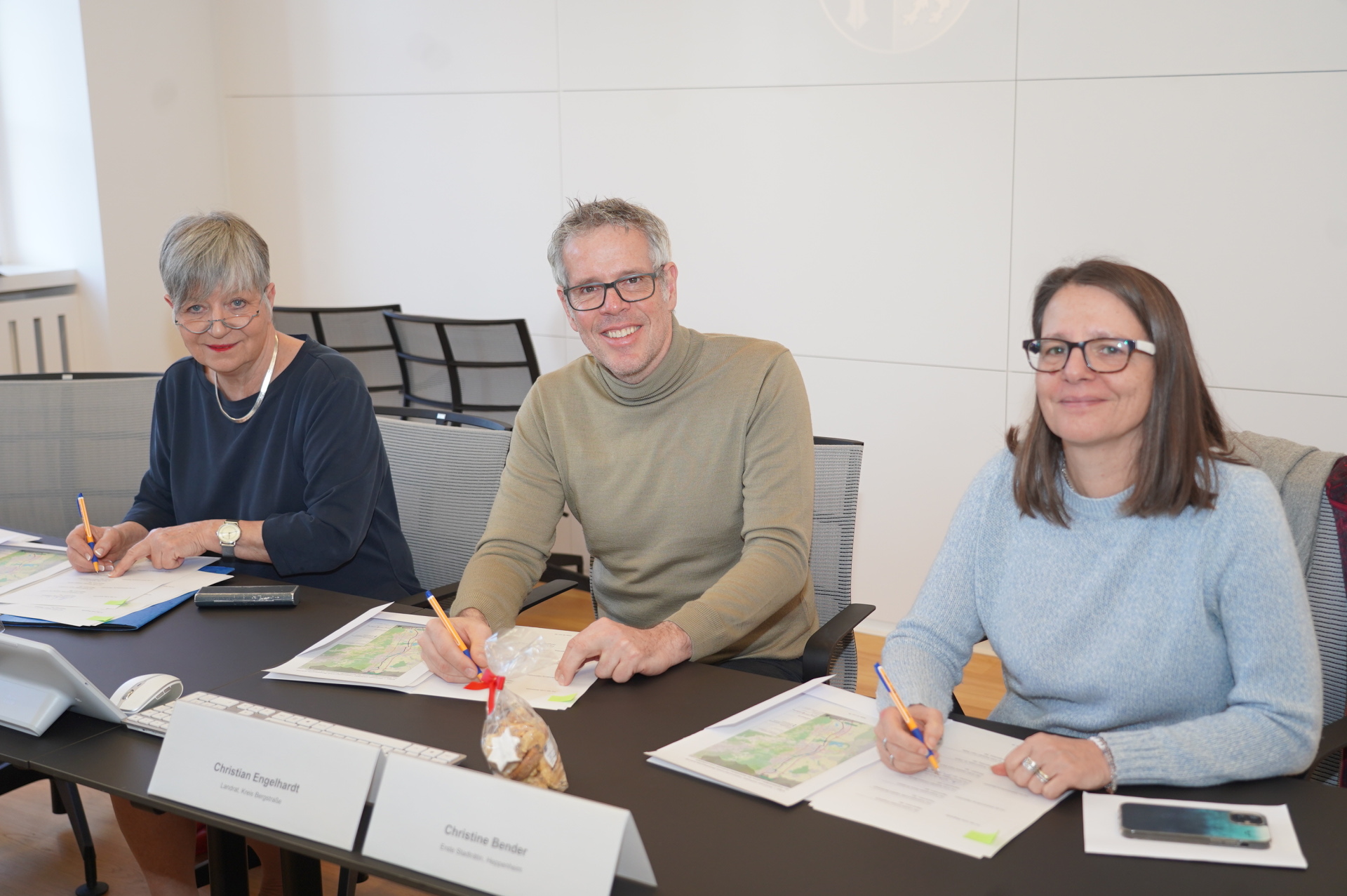Raddirektverbindung Zwingenberg – Heppenheim
Das Radfahren im Kreis Bergstraße wird immer beliebter – sei es für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Verabredungen. Fahrradfahren ist umweltfreundlich, macht Spaß und fördert die Gesundheit. Dank technischer Weiterentwicklungen, insbesondere bei Elektrofahrrädern, können zudem größere Entfernungen schneller und mit geringerem Kraftaufwand überwunden werden.
Um den Pendlerinnen und Pendlern, die bereits das Fahrrad nutzen, sowie denjenigen, die vom Auto auf das Fahrrad umsteigen möchten, eine sichere und komfortable Verbindung zu bieten, werden immer mehr Radschnellwege gebaut. Radschnellwege, zu denen auch Raddirektverbindungen zählen, besitzen ein besonders hohes Potenzial, den Pendlerverkehr vom Auto auf das Fahrrad zu verlagern und so den Anteil der Radpendlerinnen und -pendler zu erhöhen. Sie zeichnen sich durch große Breiten, eine hochwertige Oberflächenqualität und eine bevorrechtigte Verkehrsführung – insbesondere an Knotenpunkten – aus.
Ziel der Raddirektverbindung ist eine eine leistungsstarke Verbindung zwischen den Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Sie soll zugleich an die von Frankfurt kommende, Richtung Süden verlaufende Radschnellverbindung im benachbarten Landkreis Darmstadt-Dieburg anschließen. Auf diese Weise entsteht ein durchgehendes Netz aus Radschnell- und Raddirektverbindungen, auf dem weite Entfernungen schnell und sicher zurückgelegt werden können.
Um dieses Ziel zu erreichen und die Raddirektverbindung zwischen Zwingenberg und Heppenheim zu realisieren, haben sich der Kreis Bergstraße sowie die Kommunen Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim bereits im Jahr 2024 zusammengeschlossen. Der Kreis Bergstraße unterstützt die beteiligten Städte und Gemeinden sowohl organisatorisch als auch finanziell bei der Umsetzung des Projekts.